- 0231 9920780
- info@grieseler-gmbh.de
- Mo - Do: 08:00 - 16:30 | Fr: 08:00 - 15:00
Radon ist ein unsichtbares, geruchsneutrales Gas. Seine radioaktiven Zerfallsprodukte erhöhen das Risiko für Lungenkrebs. Deshalb müssen Arbeitgebende und Bauherren in Radon-Vorsorgegebieten bestimmte Maßnahmen ergreifen. Grundlage dafür ist die Radonmessung, die konkrete Informationen über Radonbelastung in Innenräumen liefert.
Wir führen professionelle Radonmessungen an Arbeitsplätzen und in Privathaushalten durch – deutschlandweit. Mit unserer professionellen Langzeitmessung und der verlässlichen Auswertung durch unser Partnerlabor erhalten Sie präzise Ergebnisse zur Radonkonzentration in Ihrem Gebäude.
Erfahren Sie, ob und welche Maßnahmen Sie gegen Radon ergreifen müssen. Um Ihre und die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden zu schützen.

Radon ist unsichtbar, geruchlos, geschmacksneutral und nicht spürbar. Und genau deshalb besonders tückisch und gefährlich. Denn das Gas steigt vom Erdreich in die Luft auf – auch innerhalb von Gebäuden. Dort konzentriert es sich und wird permanent eingeatmet. Radionuklide gelangen in die Lunge, lagern sich ab und sind der zweithäufigste Auslöser von Lungenkrebs. Rund 10 Prozent der Gebäude in Deutschland weisen eine erhöhte Konzentration auf.
Um die Gefahr von Radon überhaupt einschätzen zu können, sind Radonmessungen notwendig. Eine Langzeitmessung über 12 Monate gibt Aufschluss darüber, wie hoch die Radonkonzentration in der Raumluft ist. Durch die Messung kann der konkrete Handlungsbedarf ermittelt werden. So können beispielsweise auch mögliche Ausbreitungswege des gefährlichen Gases identifiziert und nachhaltig blockiert werden.
In Radon-Vorsorgegebieten gelten gesetzliche Pflichten für Bauherren und Arbeitgebende. Bei Neubauten müssen bauliche Maßnahmen getroffen werden, um das Eindringen von Radon weitgehend zu verhindern. An Arbeitsplätzen muss die Radonkonzentration über einen langen Zeitraum gemessen werden. Bei Überschreitung des Referenzwerts müssen Maßnahmen zum Arbeitsschutz ergriffen werden.

Arbeitgebende haben eine besondere Verantwortung für ihre Beschäftigten. Der Schutz vor Radon ist im Strahlenschutzgesetz geregelt. Befinden sich Arbeitsplätze in Gebäuden und stehen diese Gebäude in Radon-Vorsorgegebieten, muss der Arbeitgebende die Radonkonzentration in der Raumluft messen lassen. Gleiches gilt für Arbeitsplätze außerhalb der Vorsorgegebiete, in denen Radon eine erhöhte Konzentration zu erwarten ist – beispielsweise in Bergwerken und bestimmten Wasserwerken. Landesbehörden können Messungen an Arbeitsplätzen auch außerhalb von Vorsorgegebieten anordnen.

Für private, bereits bestehende Wohngebäude können die Eigentümer und Bewohner freiwillige Radonmessungen durchführen lassen, um die Konzentration in ihren Räumen zu ermitteln. Da die Sensibilität für die Thematik – nicht zuletzt durch die steigende Zahl der Krebserkrankungen – zunimmt, machen immer mehr Privatpersonen zum Schutz ihrer Gesundheit davon Gebrauch. Verschaffen Sie sich Gewissenheit über die Gesundheitsgefährdung in den eigenen vier Wänden und schaffen Sie gezielt Abhilfe, wenn eine erhöhte Radonkonzentration ermittelt wird. Die Radonmessung ist unkompliziert und preiswert. Sie ist eine sinnvolle Investition in Ihre persönliche Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Familie oder Mieter.
Radon ist ein radioaktives Edelgas, das seit Entstehung der Erde natürlich im Boden vorkommt. Es entsteht durch den Zerfall von Uran und Radium, die in Gesteinen und Böden vorhanden sind. Da es gasförmig ist, kann es aus dem Boden aufsteigen. Radon sammelt sich in schlecht belüfteten Kellern und Erdgeschossen. Das Gas verbreitet sich von dort gegebenenfalls in anderen Bereichen des Gebäudes. Weil man Radon nicht sieht, nicht riecht und auch nicht schmecken kann, handelt es sich um ein unterschätztes Risiko.
Radon selbst ist zwar ein Edelgas und chemisch inert, aber seine Zerfallsprodukte sind radioaktiv. Diese Partikel können eingeatmet werden und sich in der Lunge ablagern, was das Risiko für Lungenkrebs erhöht. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.
Radon liefert weltweit den mit Abstand größten Beitrag zur Strahlenbelastung der Bevölkerung. An der Luft verteilt sich das Gas recht schnell, in Gebäuden jedoch wird es angereichert. Die Radonkonzentration in Innenräumen stellt daher die eigentliche Gefahr dar.
Radon gelangt über die Luft in unsere Atemwege und schließlich in die Lunge. Radioaktive Zerfallsprodukte wie Blei, Polonium und Bismut verbleiben dort. Radon kann in erhöhter Konzentration das Erbgut menschlicher Zellen schädigen, woraus sich später Krebszellen entwickeln können. Schon eine leicht erhöhte Radonkonzentration über mehrere Jahre hinweg erhöht das Krebsrisiko messbar.
Für Radon gibt es keinen Schwellenwert, unter dem das Gas ungefährlich ist. Stattdessen steigt das Lungenkrebsrisiko mit zunehmender Konzentration kontinuierlich an. Je 100 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft langjähriger Radonkonzentration erhöht es sich um etwa 16 Prozent.
Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb keinen offiziellen Schwellenwert festgelegt. Auch im Strahlenschutzgesetz ist lediglich ein Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft festgelegt. Dieser Referenzwert gilt auch für Arbeitsplätze.
Radon wird aus Böden und Gesteinen freigesetzt und verteilt sich in den Poren des Erdbodens. Von dort gelangt es in die Atmosphäre. Besonders hohe Konzentrationen werden in Gegenden mit granitartigem oder uranhaltigem Gestein gemessen. In Deutschland sind vor allem Gebiete wie das Erzgebirge, der Bayerische Wald und der Schwarzwald betroffen. Das sind klassischerweise die sogenannten Radon-Vorsorgegebiete.
Erhöhte und sogar stark erhöhte Radonwerte werden regelmäßig jedoch auch außerhalb von Radon-Vorsorgegebieten gemessen. Da viele Faktoren Einfluss auf die Radonkonzentration im Erdreich haben, stellt die Lage des Gebäudes keine hundertprozentige Sicherheit dar. Vielmehr wiegen sich viele Eigentümer und Bewohner in trügerischer Sicherheit, weil sie keine konkrete Kenntnis von der Radonkonzentration in ihren Räumen haben.
Zunächst muss die Radonkonzentration in Innenräumen bestimmt werden. Radonmessungen erfolgen üblicherweise über einen langen Zeitraum, da die Radonkonzentration abhängig von der Jahreszeit, etc. schwankt. Daher wird meist über 12 Monate gemessen.
Schnelle Hilfe, um die Radonkonzentration zu reduzieren, verspricht das regelmäßige Lüften. Wie häufig, hängt von der durch die Messung ermittelten Konzentration ab. Lüften reduziert das Radon in der Luft jedoch nur kurzzeitig. Es verringert zwar die Konzentration, packt das Problem aber nicht an der Wurzel an.
Radon gelangt durch Löcher und Risse in Fundamenten, Böden und Wänden in den Innenraum des Gebäudes und unter Umständen auch in höhergelegene Stockwerke. Um das Eindringen zu verhindern, müssen Eintrittsstellen fachmännisch abgedichtet werden.
In stark betroffenen Gebieten oder nur schwer abzudichtenden Gebäuden können technische Maßnahmen wie Radonbrunnen und Lüftungssysteme helfen, Radon aktiv und vor allem schnell aus Kellern und Wohnräumen abzuleiten.

Radon steigt aus dem Erdreich auf und gelangt durch undichte, spröde oder rissige Fundamente und Böden in das Gebäudeinnere. Oft entlang von Rohren und Leitungen, die nicht sauber abgedichtet wurden. Zusätzlich diffundiert Radon abhängig von der Struktur durch das Material von Fundamenten und Böden.

Viele Baumaterialien bestehen aus natürlichem Gestein und sind daher von Natur aus mit Uran und Radium belastet. Durch den Zerfall von Uran und Radium entsteht Radon, das freigesetzt wird und in die Raumluft übergeht.

Radon ist leicht in Wasser löslich. Es kann daher über Wasserleitungen in Gebäude gelangen. Beim Verwenden des Trinkwassers, beispielsweise durch Duschen oder Kochen, wird das Gas freigesetzt. Durch Trinken wird ebenfalls Radon aufgenommen.
Dort, wo die Radonkonzentration besonders hoch ist, müssen die Bundesländer ein sogenanntes Radon-Vorsorgegebiet ausweisen. In diesen Risikogebieten wird der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter in der Raumluft überdurchschnittlich häufig überschritten.
In Radon-Vorsorgegebieten besteht für Bauherren die Pflicht, bauliche Maßnahmen zu ergreifen, damit das Eindringen von Radon in das Gebäude so gut wie möglich verhindert wird.
Auch Arbeitgebende müssen zum Schutz ihrer Beschäftigten Maßnahmen ergreifen, um die Radonkonzentration zu reduzieren. Dem voraus geht die Radonmessung, um die Konzentration in der Raumluft festzustellen, mögliche Quellen zu identifizieren und Maßnahmen zur Radonreduktion abzuleiten.
Deutschlandweit führen sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen und Behörden Radonmessungen durch, um das Risiko im eigenen Gebäude abschätzen zu können und geeignete Reduktionsmaßnahmen zu ergreifen.
Je nach der notwendigen Messdauer verwenden wir gezielt dafür entwickelte Radonmessgeräte – sogenannte Kernspurendetektoren. Diese Geräte können auch zur personenbezogenen Radondosimetrie eingesetzt werden. Die Messgeräte bieten eine außerordentlich große Spannbreite des Expositionsbereiches. So können sowohl besonders niedrige Werte wie 15 Becquerel pro Kubikmeter als auch besonders hohe Werte wie 25.000 Becquerel pro Kubikmeter innerhalb der Messperiode nachgewiesen werden.
Die Radonmessgeräte sind klein, unauffällig und unkompliziert. Sie werden von unseren Experten an den geeigneten Stellen im Gebäude angebracht. Es ist weder ein Stromanschluss noch eine andere technische Infrastruktur notwendig. Die Geräte benötigen auch bei einer Langzeitmessung keine Pflege oder Wartung.
Radon ist ein unbekanntes und unsichtbares Risiko. Deshalb sind Arbeitgebende aller Art – also nicht nur Unternehmen, sondern beispielsweise auch Behörden – seit 2021 dazu verpflichtet, die Radonkonzentration am Arbeitsplatz zu messen. Vorausgesetzt, die Arbeitsstätte befindet sich in einem Radon-Vorsorgegebiet.
Die Radonmessung erfolgt ununterbrochen über 12 Monate, da die Konzentration stark schwanken kann. Für die Messung müssen spezielle Messgeräte von anerkannten Anbietern verwendet werden. So wird die bundesweit einheitliche Messqualität sichergestellt. Die Messgeräte müssen dort angebracht werden, wo die Arbeitskräfte tatsächlich tätig sind. Am besten in Kopfhöhe. Es ist darauf zu achten, dass die Messgeräte über den langen Zeitraum nicht entfernt oder verdeckt werden – auch nicht temporär.
Wir stellen Ihnen verlässliche Radonmessgeräte zur Verfügung. Unser geschultes Personal bringt diese an den geeigneten Messstellen an. Nach der Messperiode von 12 Monaten werden die Messungen in unserem Partnerlabor ausgewertet.
Eine hohe Belastung der Raumluft mit Radon liegt bei mehr als 300 Becquerel pro Kubikmeter vor. Ab diesem Wert müssen Arbeitgebende Maßnahmen ergreifen. Selbstverständlich beraten wir Sie zu den Testergebnissen sowie zu möglichen Maßnahmen, die den Radongehalt in Ihren Räumlichkeiten nachhaltig reduzieren.
Nachdem Sie uns mit der Messung der Radonkonzentration in Ihrem Gebäude beauftragt haben, vereinbaren wir einen Termin zur Installation der Messgeräte. Wir bringen diese in ausreichender Stückzahl an geeigneten Messpunkten an und weisen Sie darauf hin, was für eine möglichst exakte Bestimmung zu beachten ist.
Nach der vereinbarten Messdauer holen wir die Radonmessgeräte wieder ab und übergeben Sie unserem akkreditieren Partnerlabor. Dort wird für jedes Gerät und damit jeden Raum oder Arbeitsplatz die individuelle Radonkonzentration nach geltenden Standards ermittelt.
Wir übermitteln Ihnen die Messergebnisse und ordnen diese für Sie ein. Auf dessen Grundlage beraten wir bei Bedarf gern zu geeigneten Maßnahmen, um die Radonkonzentration in Ihrem Gebäude zu verringern.
.
Als einer der führenden Anbieter für Schadstoffgutachten, Verkehrssicherheit und weiteren Ingenieursdienstleistungen betreuen wir eine Vielzahl an Kunden. Neben privaten Immobilieneigentümern setzen vor allem große Wohnungsbaugesellschaften, Immobilieninvestoren und Kommunen auf unsere Expertise.


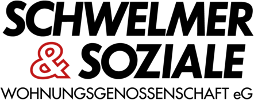


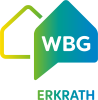

Hauptgeschäftsstelle
Mengeder Schulstr. 4
44359 Dortmund
Geschäftsstelle
Süddeutschland
Senngutweg 4
88316 Isny im Allgäu
Montag – Donnerstag
08:00 Uhr – 16:30 Uhr
Freitags
08:00 Uhr – 15:00 Uhr
grieseler gmbh | 2024 | Impressum | Datenschutz | AGB